Der Freigeist…
…der mit seinem Spitznamen Pate steht für die Denk-Werkstatt der Texterei Schramm, wurde vom Literaturwissenschaftler Dieter Hildebrandt als „Genie des Ärgernisses“ bezeichnet. Christlob Mylius (1722-1754), so sein bürgerlicher Name, wird oft zusammen mit G. E. Lessing erwähnt, weil sie eng befreundet waren und eine Zeitlang zusammen publizierten. Sie waren eher verschwägert als verwandt, doch eine gewisse Brüderlichkeit gründet bereits in ihrer Herkunft. Beide sind Pastorensöhne der Oberlausitz. Mylius ist nur 6 Jahre älter als Lessing. Beide sorgen für Unruhe im Establishment und beide haben die Aufklärung im Blut – den Drang nach Wissen und eine erfrischende Geringschätzung für Konventionen.
 … und sein Image
… und sein Image
In Leipzig, der pulsierenden Aufklärungsmetropole, studiert Mylius Medizin. Die Naturwissenschaft ist seine große Leidenschaft, doch er findet kein Auskommen auf diesem Gebiet. Also hält er sich über Wasser mit dem, wofür er leichter Kundschaft findet: Er schreibt. In Leipzig gehört er zu den jungen Ghostwritern um den Poetik-Professor Johann Christoph Gottsched. Aus diesem Abhängigkeitsverhältnis bricht Mylius bald aus und gründet selbst Zeitschriften. Bereits die erste, Philologische Untersuchungen und Nachrichten (1744-1746), eckt mit religionskritischen Aufsätzen an. Die protestantische Orthodoxie möchte Fragen der Religion nicht in der Öffentlichkeit thematisiert sehen. Ein echter Aufklärer fasst das als Herausforderung auf, denn alles „geht uns an, alles ist für uns gemacht“,1 so Voltaire. Bereits 1745 nutzt Mylius sein Image für die Gründung der zweiten Zeitschrift mit dem Titel Freygeist. Sie erscheint ein ganzes Jahr lang und bringt es auf 52 Ausgaben. Das ist in der Anfangszeit des Mediums eine ordentliche Leistung, zumal sich das Blatt mit seinem provokanten Titel ganz offen auf eine Konfrontation mit den geistlichen und kulturellen Autoritäten einlässt. Frech und vernünftig ist der Freygeist. Hildebrandt charakterisiert die Texte als Zeugnisse „von der dringlichen Sehnsucht des Aufklärers, Vernunft und Glauben, Gott und die Erscheinungen dieser Welt so überein zu bringen, daß der Verstand nicht abdanken muß.“2 Die Themen seiner Texte verraten Mylius immer als Mediziner und Naturwissenschaftler. Auf pfiffige Weise bindet Mylius seinen Schwerpunkt regelmäßig in seine Publizistik ein, z. B. in dem Aufsatz „Wider die galante Folter der Schnürbrüste“3 im Naturforscher (1747-1748), einer nicht streng wissenschaftlichen Wochenschrift aus seiner Feder.
In Leipzig freundet sich Mylius mit Lessing an und nimmt ihn unter seine Fittiche. Vielleicht war er es, der den jungen Gelehrten aus seiner Studierstube lockte und ihm klar machte, wie wichtig es ist, das Leben zu studieren und unter Leute zu kommen – einer der großen Wendepunkte in Lessings Biografie.

Gazetten, Glanz und Gloria
Eine Sonnenfinsternis lockt Mylius im Sommer 1748 nach Berlin. Er bleibt noch etwas länger und beobachtet zusammen mit dem Mathematiker Leonhard Euler (1707-1783) die 14 Tage darauffolgende Mondfinsternis. Und wenn er schon mal da ist, im aufgeklärten Berlin, dann bleibt er eben und mischt die Printmedien der preußischen Metropole auf.
Friedrich II. ist ein großer Förderer der Aufklärung, ein Freund der Bücher und der Zeitung. Gleich zu Beginn seiner Regierung 1740 erlässt er die Pressefreiheit mit dem Befehl, „daß dem hiesgen Berlinischen Zeitungsschreiber eine unumschränkte Freiheit gelassen werden soll“ und „daß Gazetten, wenn sie interessant sein sollten, nicht geniert werden müßten.“4 Ideale Bedingungen für Mylius! 1749 gründet er in Berlin die nächste Zeitschrift, den Wahrsager, der es allerdings auf nur 20 Ausgaben bringt. Das Gesellschaftsblatt mit jeder Menge Klatsch, Tratsch und Skandal steht unter keinem guten Stern.
Schnelle Texte, schmutzige Wäsche, gutes Geld – das ist das ungenierte Konzept des Wahrsagers. Offensichtlich verpackte der Autor die gut verkäufliche Ware nicht anständig genug. Lessing, der Mylius nach Berlin gefolgt ist und sich auch als Journalist verdingt, charakterisiert die Zeitschrift wie folgt: „Die Schreibart ist nachlässig, die Moral gemein, die Scherze sind pöbelhaft, und die Satyre ist beleidigend. Er schonte niemanden und hatte nichts Schlechteres zur Absicht, als seine Blätter zur scandalösen Chronik der Stadt zu machen.“5
Letztendlich erreicht Mylius mit dem Wahrsager die Wiedereinführung der Zensur in Preußen. Doch eigentlich haben Autoren ganz anderer Prominenz den König an die Grenzen seiner Toleranz getrieben.
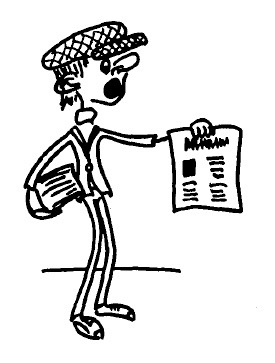
Ideal – ein Skandal!
Zu den Lieblingsprojekten Friedrichs II. gehört die königliche/preußische Akademie der Wissenschaften in Berlin, eine der zentralen Institutionen der Aufklärung, die der König mit französischen Philosophen schmückt. Mit ausgewählten Denkern trifft er sich täglich zu einer geistreichen Tafelrunde. Der Arzt und Autor Julien Offray de La Mettrie (1709-1751), der dichtende Philosoph Voltaire (1694-1778) und viele andere finden in Potsdam Auskommen, Unterkunft und königliche Anerkennung, auch wenn sie bei ihren Heimatfürsten in Ungnade gefallen sind.
Im großen moralphilosophischen Diskurs könnte man die Akademie als Bastion der Freigeister bezeichnen. Gegen militärische Metaphern hat der Alte Fritz sicher nichts einzuwenden. Orthodoxe, vernünftige Christen, Deisten und Atheisten schießen scharf, um die eigene Weltanschauung zu verteidigen. Ihr kleinster gemeinsamer Nenner: Die Tugend – der Sammelbegriff für psychologisch und gesellschaftlich förderliche Eigenschaften und Verhaltensweisen. Im Ringen um Rechtfertigung beansprucht jede Partei die Tugend für sich und macht sie den Gegnern streitig. Bei kühlem Kopf könnte man sich genau in diesem Punkt treffen, aber bei Streitenden ist es mit Vernunft und Gelassenheit nicht weit her. In diesem hitzigen Tintenkrieg lässt La Mettrie immer wieder Bomben hochgehen. So zum Beispiel Ende 1748: Der Leibarzt und Vorleser des Königs übersetzt Senecas Vom glücklichen Leben (De vita beata). Dem Verleger Christian Friedrich Voß gaukelt er vor, er habe die Erlaubnis des Königs dieses Werk drucken zu lassen und stellt dem antiken Text einen explosiven Essay voran: Über das Glück oder das Höchste Gut – auch bekannt als Anti-Seneca. Darin degradiert er die Tugend zu einer von vielen, beliebigen Methoden, glücklich zu leben. Im Grunde bestimme aber der Körper über den Geist und den Willen und das Gewissen sei eine Idee, die dem persönlichen Glück nur im Wege stehe.
Das geht selbst Friedrich II. zu weit, der dem enfant terrible bislang erlaubt hat frei zu schreiben. Der Fürst hat nun auch Voß auf dem Zettel, den Verleger, bei dem auch Mylius’ Wahrsager erscheint. Eine heikle Situation, in der ein Kerl wie Mylius die Feder nicht stillhalten kann.

Roboter, Satire und das Revival der Zensur
Das anstößige Werk L’home machine (der mechanische Mensch) hat La Mettrie den Spitznamen monsieur machineeingehandelt. Bereits in einer der ersten Wahrsager-Ausgaben 1749 stellt Mylius die Theorie auf, monsieur machinesei tatsächlich eine Art Roboter und der Werkstatt des Erfinders Jacque de Vaucanson (1709-1782) entsprungen. Im Februar malt Mylius diese Idee weiter aus zu einer Satire auf die mechanischen Unterrichtsmethoden an Schulen und Universitäten.
Er demontiert La Mettrie und macht aus dessen mechanistischen Weltbild Munition für seine Kritik am Bildungssystem. Es sind zwar nur Papierkügelchen, aber die Berliner Lehrer fühlen sich angegriffen und schlagen Alarm. Wieder wird der Verleger Voß verwarnt. Bei all dem Konfliktpotential wundert es kaum, dass Regierungsbeamte schon eine ganze Weile dem König zur Wiedereinführung der Zensur raten. Die Satire steht in der Schusslinie. Kommt uns das nicht bekannt vor?
Jetzt fehlt nur noch wenig: ein anzügliches Thema, missverstandene Ironie und ein paar Stimmen, die laut genug schreien. Eine humoristische Rechtfertigung ehelicher Untreue, vermutlich aber der Lärm, den einige Rezipienten darum machen, bringt das Fass zum Überlaufen und sprengt den königlichen Geduldsfaden.
Am 17. Mai 1749 wird die Zensur eingeführt und der Wahrsager wird verboten. Den entsprechenden Erlass verkündet Kriegsminister Dohms (apropos militärische Metaphern): „Nur was auf die eine oder andere Weise den Staat angreift, was wahre Tugend beleidigt und das Laster verteidigt oder die Einbildung zur Begehung desselben geradezu anreizt, was die allgemeine und vernünftige Religion angreift, was gute Sitten und den allgemein eingeführten Wohlstand verletzt, was die Ehre und den guten Namen eines Dritten beleidigt – nur dieses darf ein Zensor in Friedrichs Staaten ausstreichen; alles übrige muß er unberührt lassen, es mag im übrigen wahr oder falsch, klug oder ungereimt, witzig oder abgeschmackt erscheinen.“6 Das klingt recht gemäßigt, hatte aber starke Hemmwirkung auf den preußischen Journalismus.
Gescheiterte Pressefreiheit
Eine warnende Geste La Mettrie und seinem übertölpelten Verleger gegenüber hatten nicht ausgereicht, um die Affäre unter den Teppich zu kehren. Nein, da kam dieser ungenierte Journalist und musste das Thema immer wieder hervorzerren, freigeistig nach dem Motto: „Alles geht uns an, alles ist für uns gemacht.“ An Mylius’ Wahrsager, statuiert Friedrich II. ein Exempel. Dabei hatte Mylus über das eigentliche Ärgernis gespottet, die Ideen von La Mettrie adaptiert und mit eigenen kritischen Aussagen aufgeladen. Seine Satire griff wohl zu oft die anstößigen Thesen des königlichen Günstlings auf. Sicherlich hatte der Wahrsager weit mehr Leser als La Mettries Schriften. Die Artikel machten den Inhalt von La Mettries Büchern erst bekannt.
Sind wir mal ehrlich: Wie oft nehmen wir politische Ereignisse, gesellschaftliche und kulturelle Skandale oder Personen des öffentlichen Interesses erst in der Comedy war? Trotz oder gerade wegen der stetig steigenden Informationsflut, denn Satire gelingt es, unser Interesse für so manche Themen erst zu wecken, indem sie mit Humor die verqueren Zusammenhänge auf einen Punkt bringt.
Ironie der Publicity: Wer ganz vorne in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit steht, bekommt auch die meiste Aufmerksamkeit der Kritiker. So kommt es zu den Forderungen, dass nicht etwa unzureichende Politik, sondern Satire in ihre Schranken gelenkt werden soll. Doch Satire kennt keine Schranken. Sie steht immer außen, blickt auf die Welt und hält uns den Spiegel vor. Sie ist ein wichtiger Informationskanal und bringt ans Licht, was für viele verborgen bliebe. Satire klärt auf!
Mylius hat seine Beobachtungsgabe schließlich intensiver der Naturwissenschaft gewidmet. Er wollte Nordamerika zu Forschungszwecken bereisen. Doch über den großen Teich hat er es nicht geschafft. Gerade 32-jährig erlag er in London einem Fieber. Spekulationen, was er alles hätte erreichen können, sind mühsam. Mylius war ein Heißsporn der Aufklärung und wagemutig vom kleinsten Zeitungswitz bis zum großen Forschungsprojekt.
1 Zit. n.: Dieter Hildebrandt: Christlob Mylius, Ein Genie des Ärgernisses, Berlin 1981, S. 27. 2 Ebd., S. 24. 3 Nachzulesen ebd., S. 87 ff. oder Christlob Mylius, Vermischte Schriften, gesammelt von Gotthold Ephraim Lessing, Berlin 1754 (Reprint 1971). 4 Zit. n.: Hildebrandt, S. 35. 5 Gotthold Ephraim Lessing: Werke und Briefe in zwölf Bänden. Band 3. Hg. Conrad Wiedemann mit Wilfried Barner und Jürgen Stenzel, Frankfurt/M. 2003, S. 340. 6 Zit. n.: Hildebrandt, S. 38.
Zum Weiterlesen
Dieter Hildebrandt: Christlob Mylius, Ein Genie des Ärgernisses, Berlin 1981.
Monika Fick: Lessing Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. Stuttgart/Weimar 2010.
Hugh Barr Nisbet: Lessing. Eine Biographie. München 2008.
Dieter Hildebrandt: Der Wahrsager https://www.tagesspiegel.de/kultur/der-wahrsager/497058.html

Unter Leute zu kommen und das Leben zu studieren – das fehlt uns gerade allen! Wir können uns nur glücklich schätzen in Zeiten weit entwickelter medizinischer Erkenntnisse zu leben.
Bei all dem organisatorischen Durcheinander bleibt uns nichts anderes übrig, als auf die Wissenschaft zu hören.
Bleiben Sie tapfer und gesund, liebe Lesende!
Ihre Christine Schramm